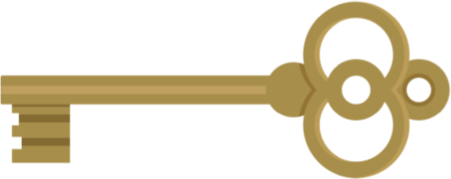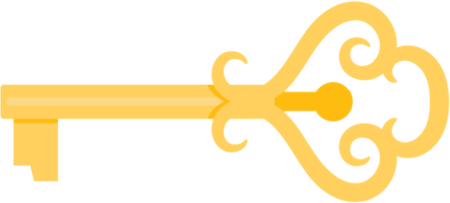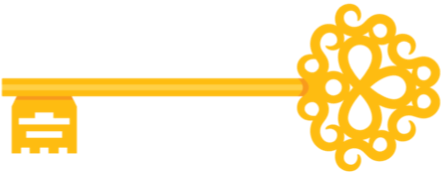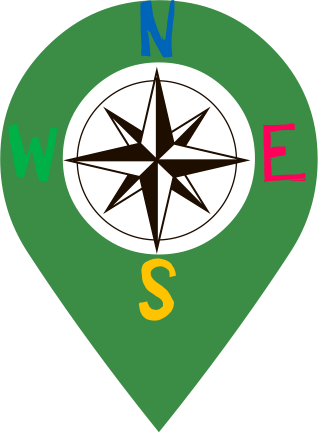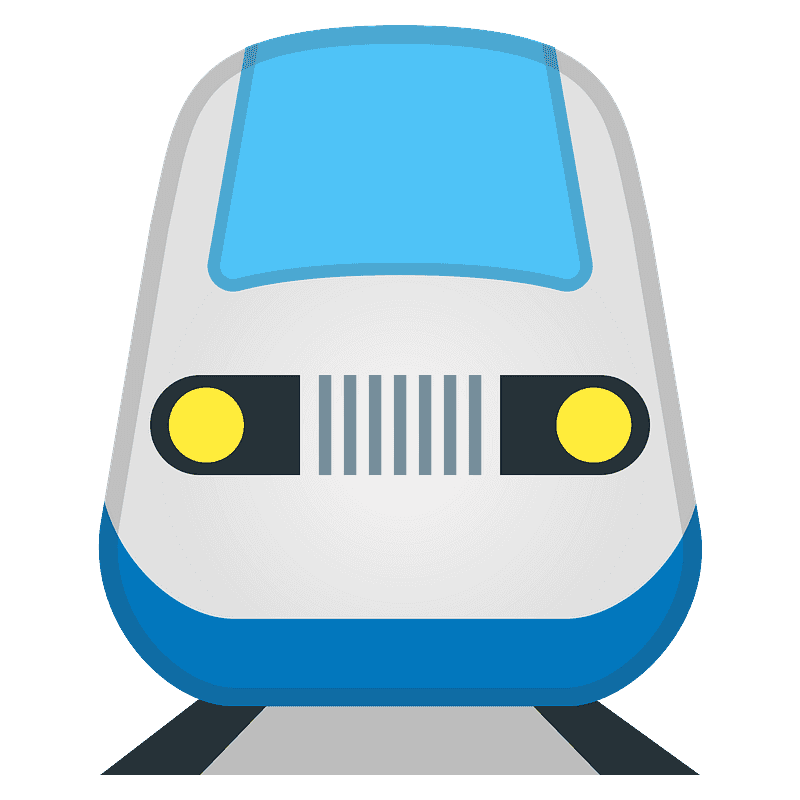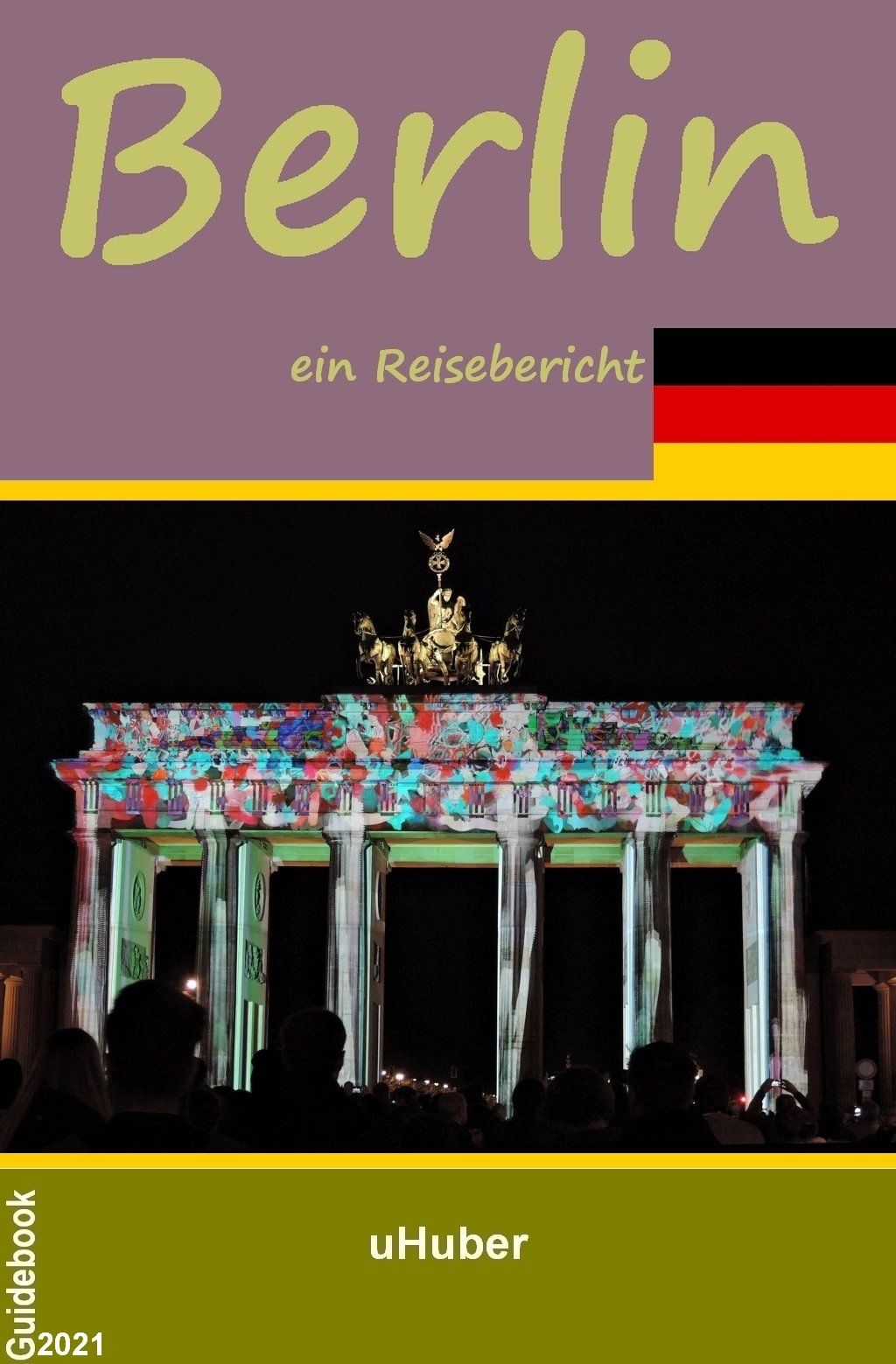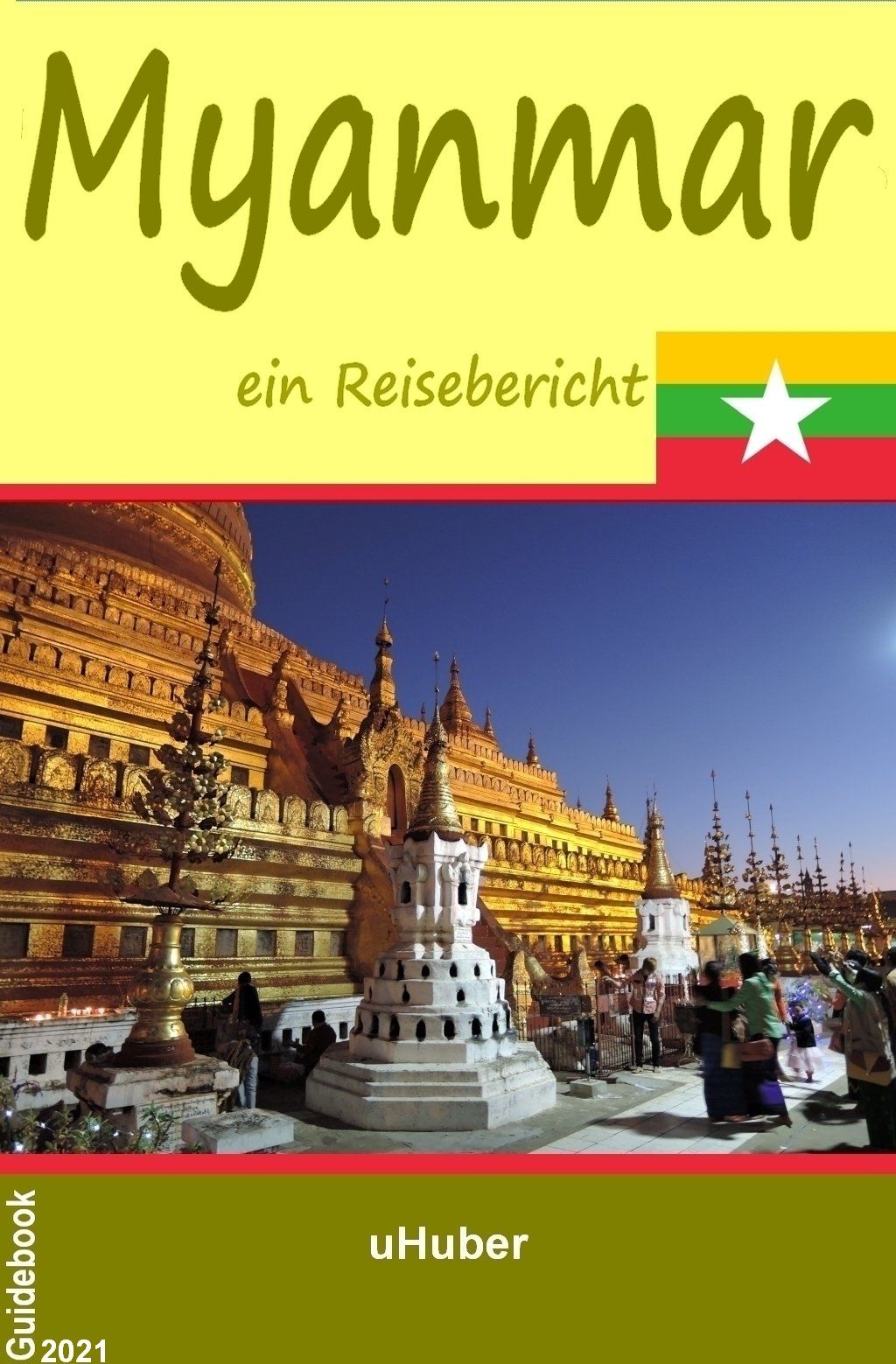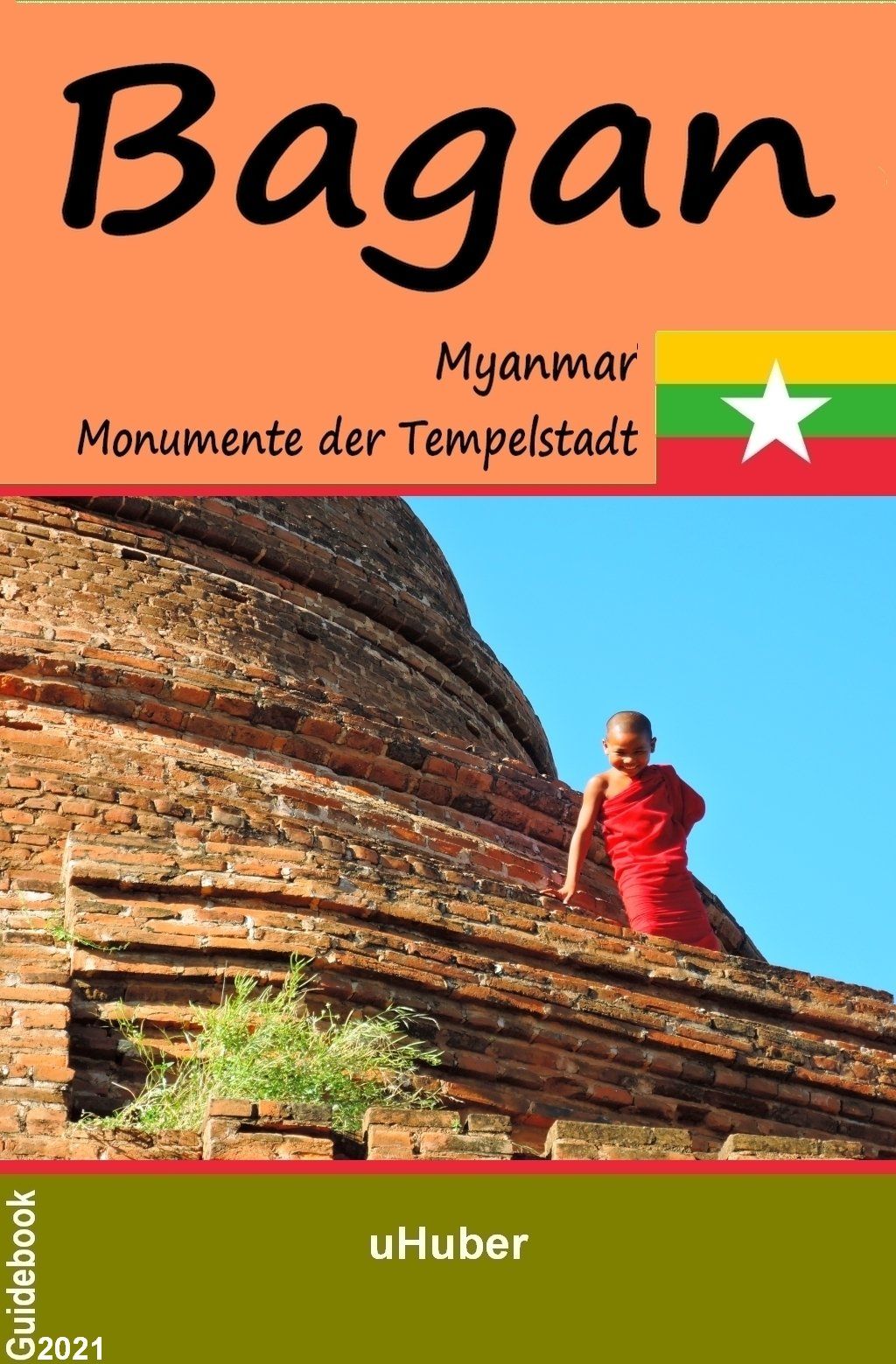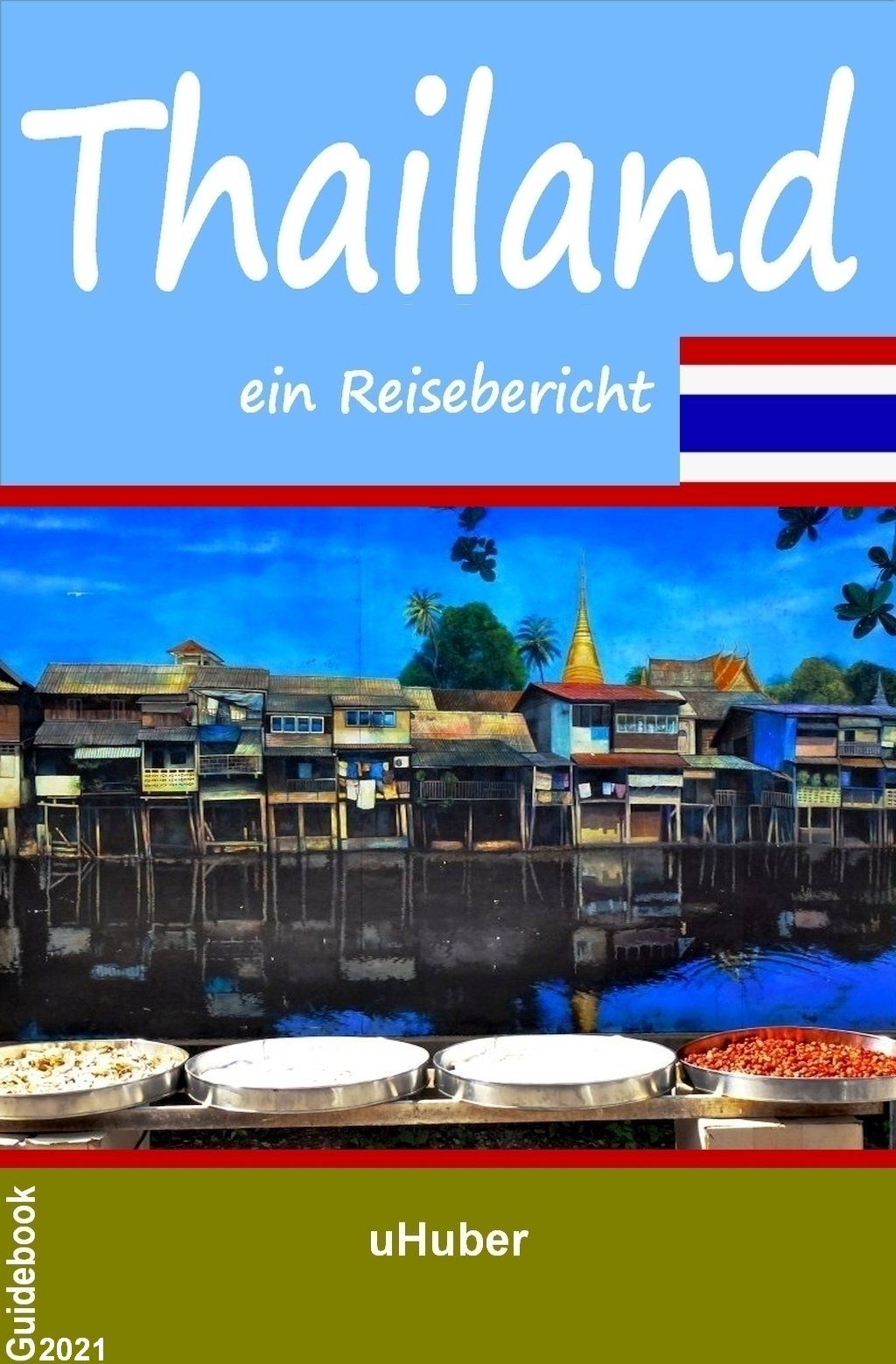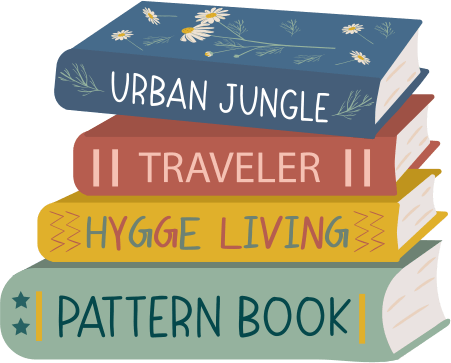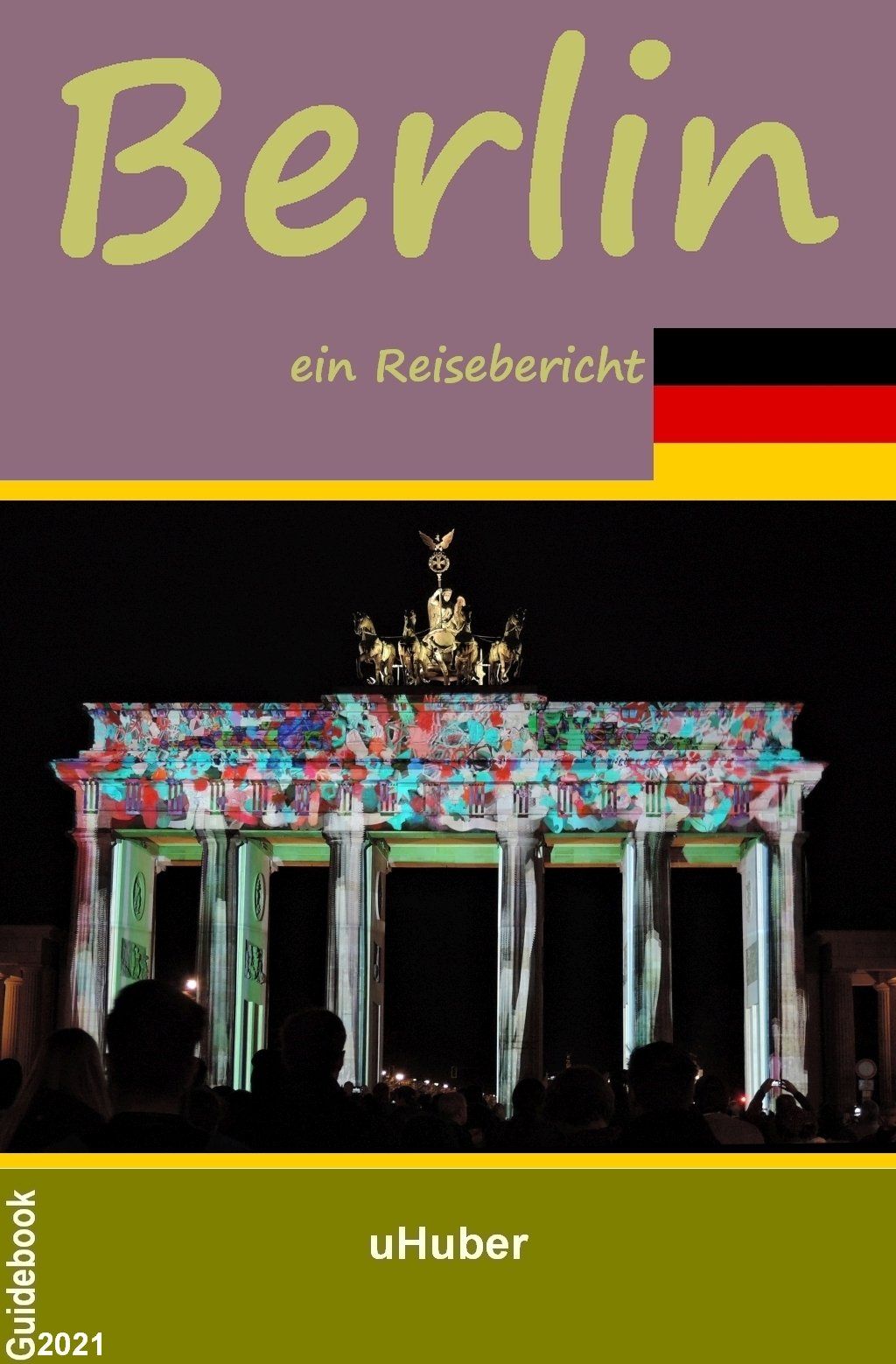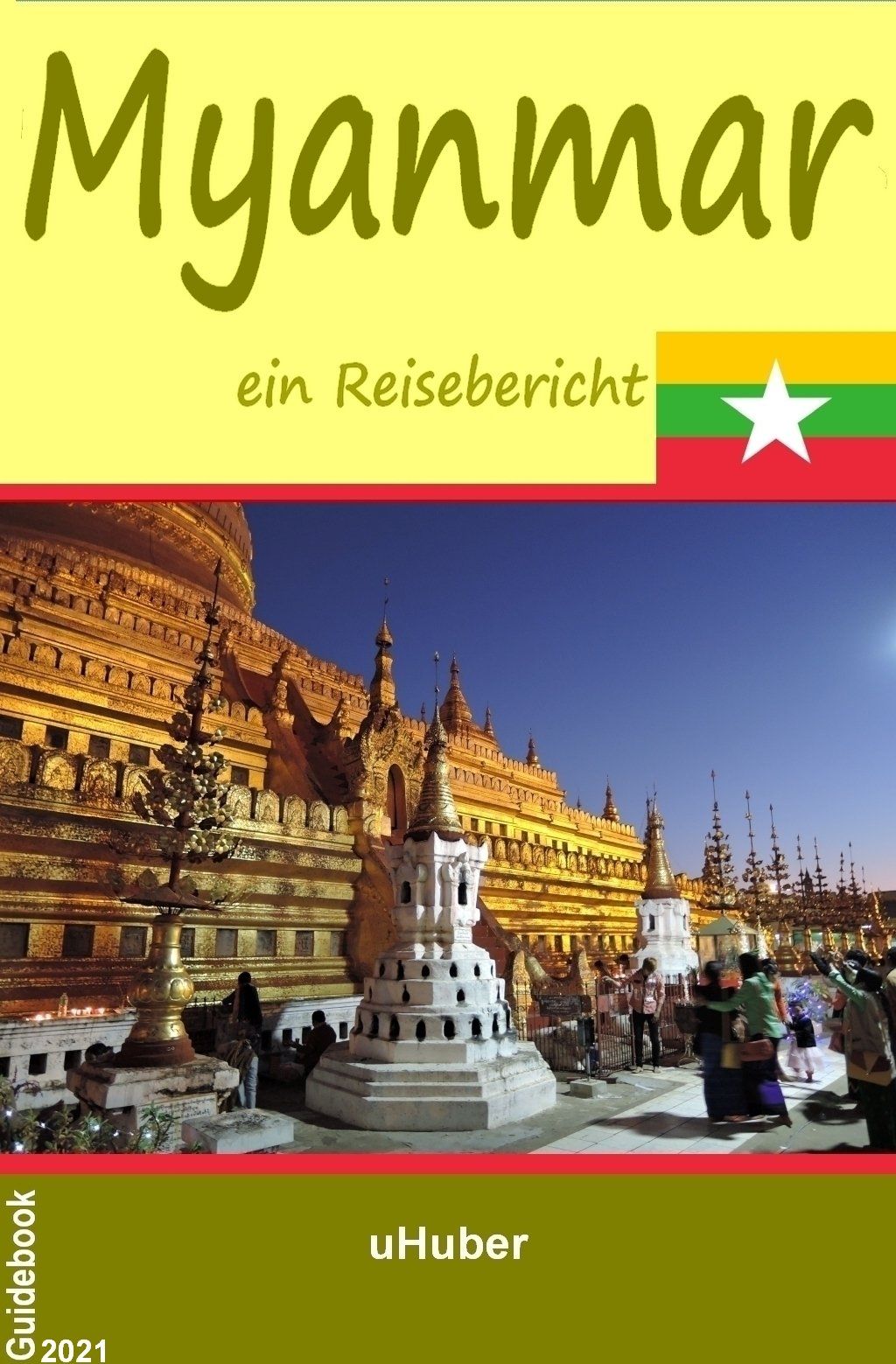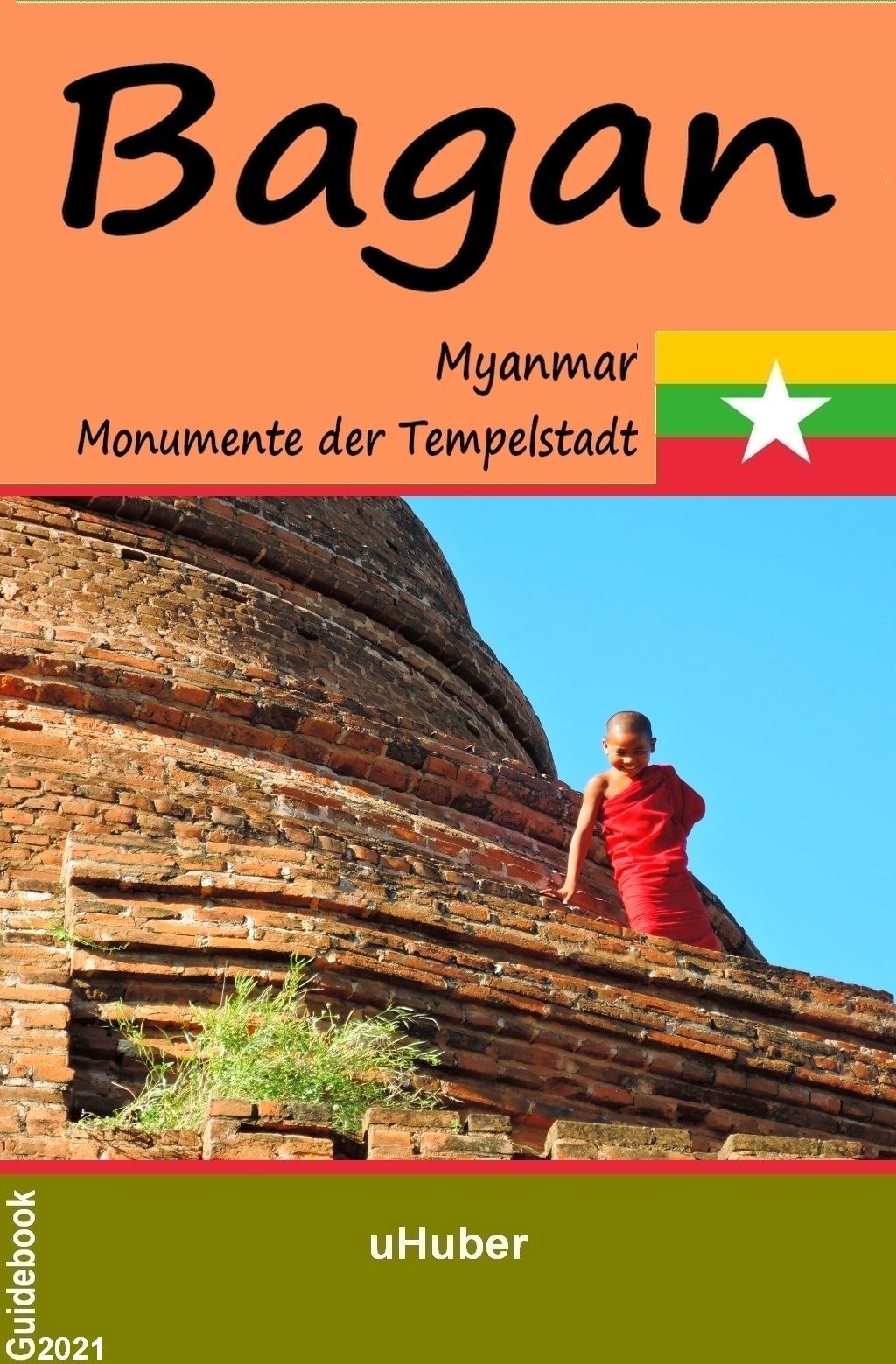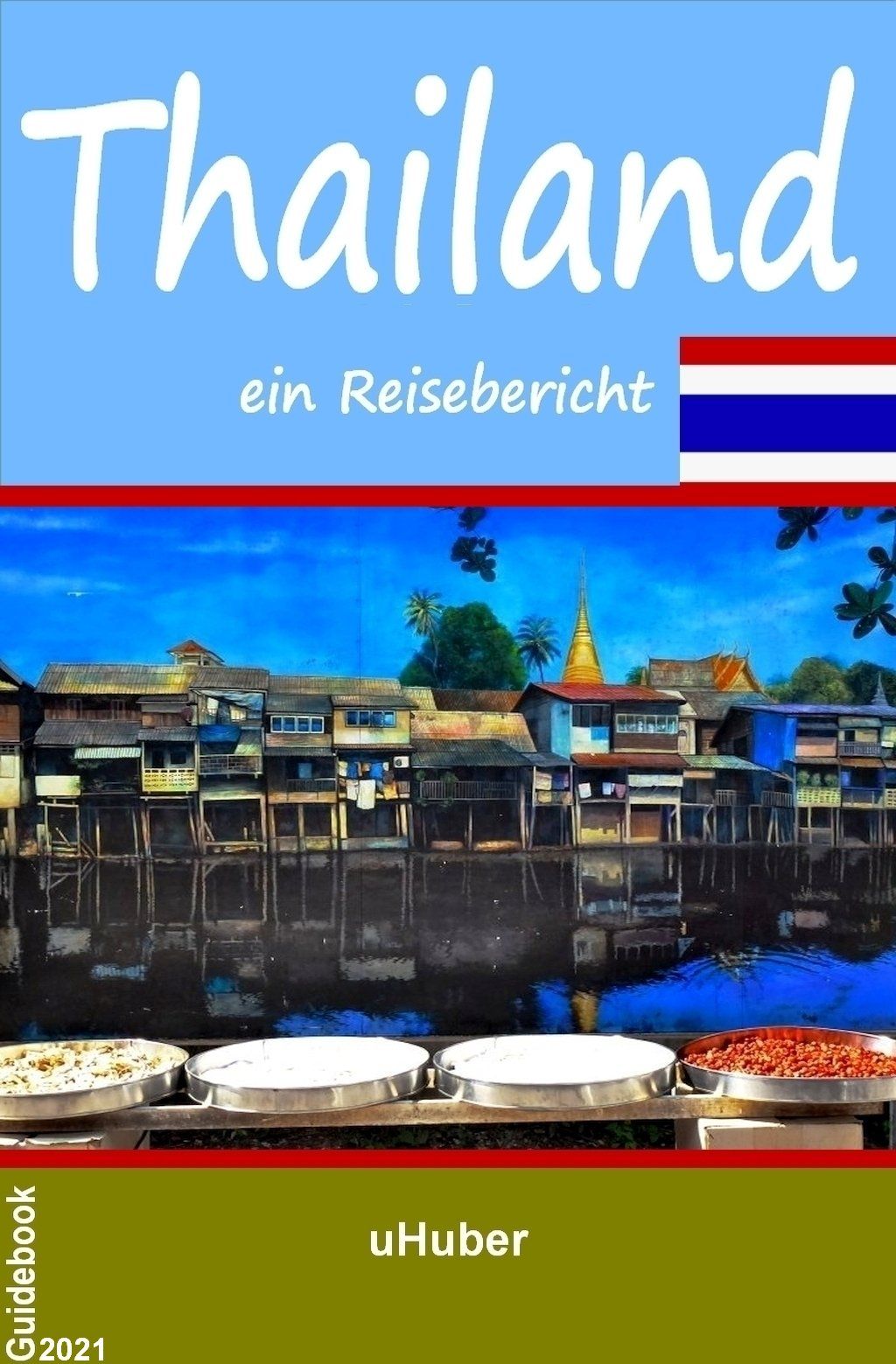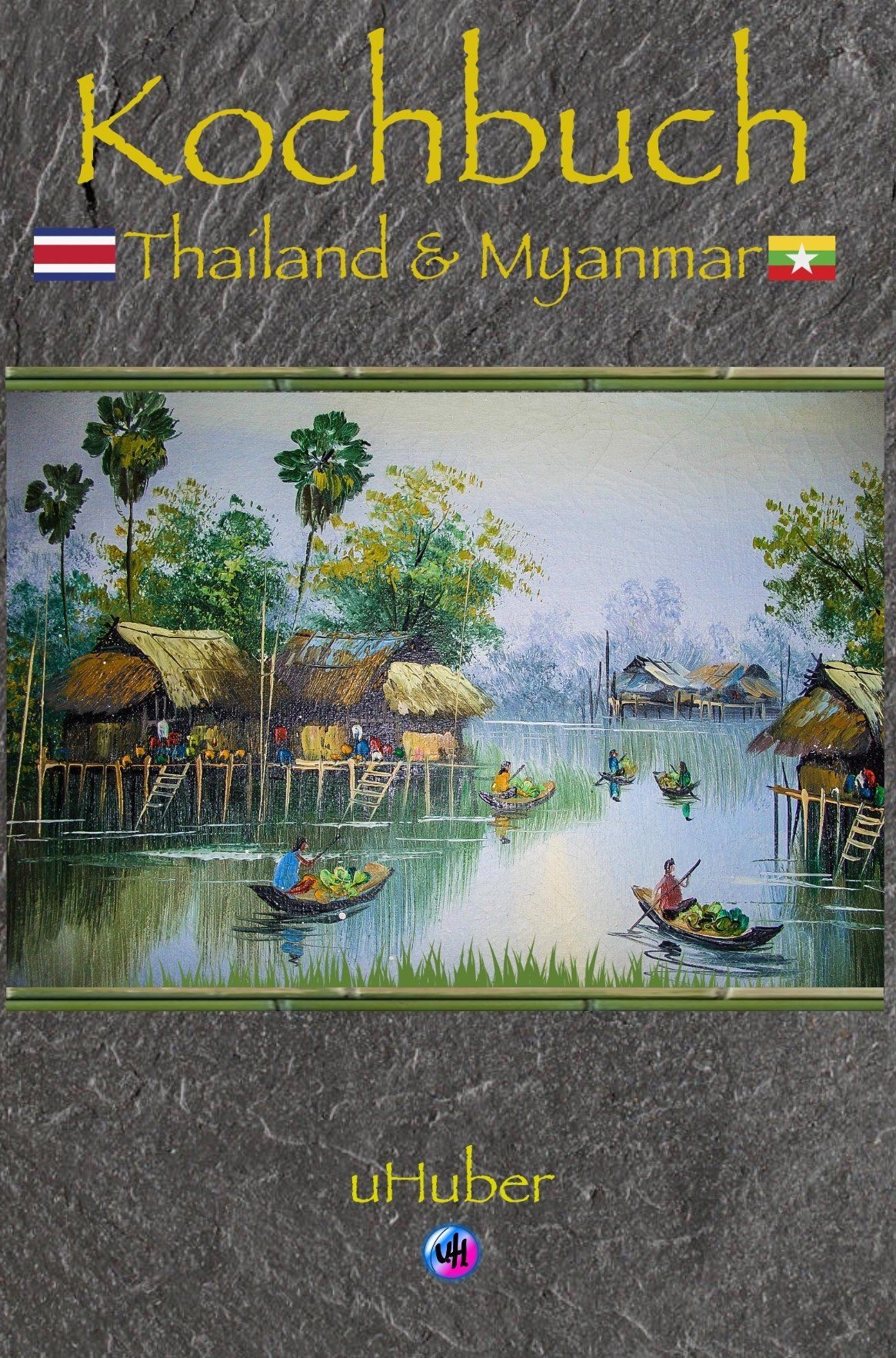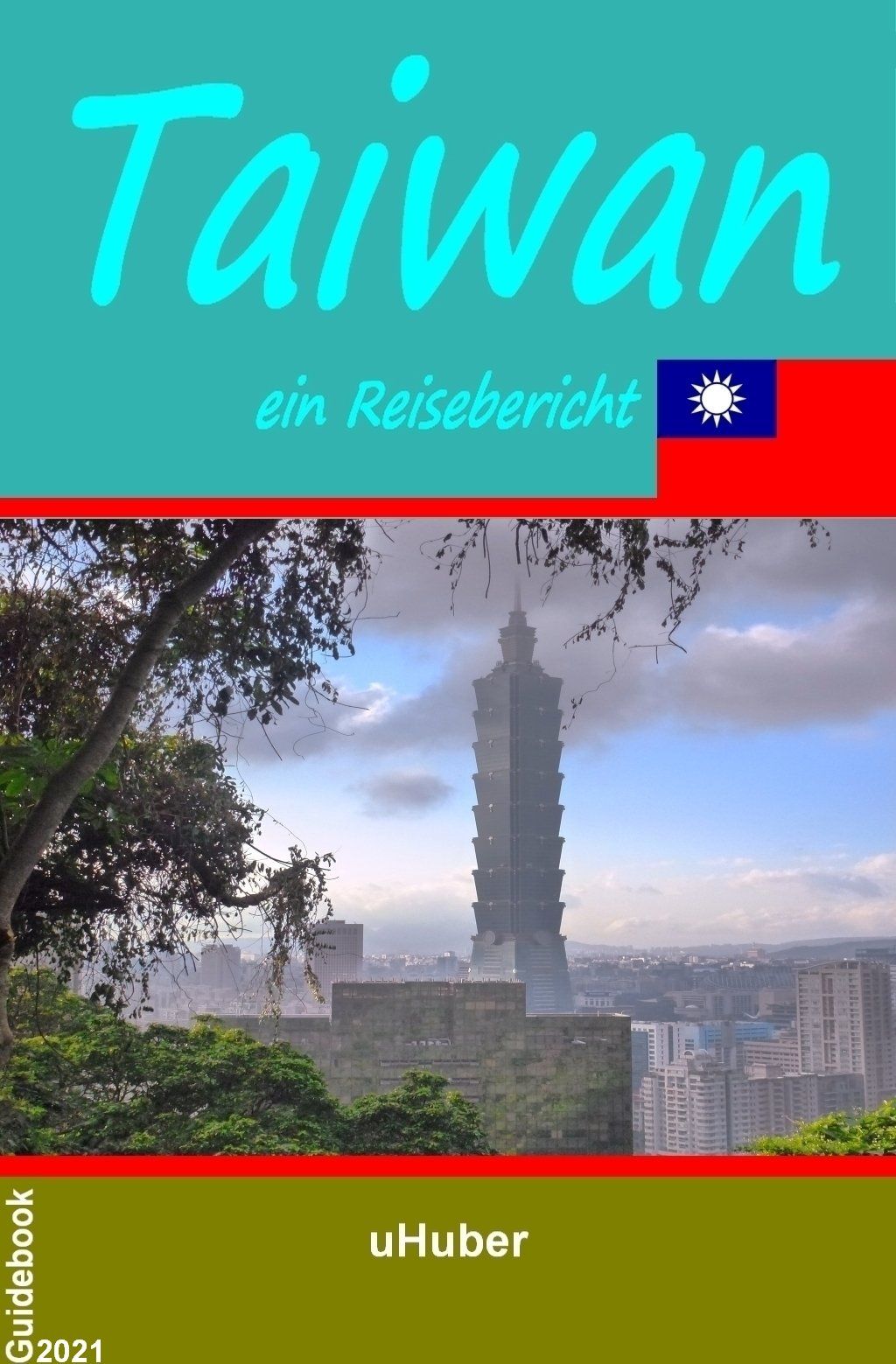Mea Shearim (übersetzt 100 Tore) betreten wir durch - ein Tor und es wird auf Tafeln darauf hingewiesen, dass die Bewohner keinen Wert auf den Besuch von Touristen legen. Besucher werden auf die Kleidervorschriften hingewiesen: "please do not pass through our neighborhood in immodest clothes" - Frauen im Rock, die Arme bedeckt, Männer mit Kopfbedeckung. Und viele Kinder. Hier ist der Bibelvers "seid fruchtbar und mehret euch" unübersehbar befolgt worden. Ein Schritt in eine andere Welt, so zumindest ist meine Erwartung. Unerwünschte Eindringlinge. Doch auch hier leben Menschen. Hier wird eingekauft, telefoniert, geraucht und Kaffee getrunken. Die andere Welt erweist sich als normal, weder bedrohlich noch abweisend. Mea Shearim will keine Touristenattraktion sein, wer will schon das Reisegruppen durch sein Wohngebiet ziehen? So bleibt als Reisender die (rhetorische) Frage nach einem Besuch. Wie man kommt so wird man empfangen. So muß man selbstverständlich die Regeln beachten: natürlich entsprechend gekleidet. und den Shabbat respektieren.

Mea Shearim
Den Stadtplan auf dem Schoß fahren wir durch Jerusalem in den Stadtteil Mea Shearim, parken in der gleichnamigen Straße - das Parkticket müssen wir in einem Geschäft kaufen und unsere Parkzeit wird darauf pro Stunde gelocht. 1874, als mit dem Bau von dem deutschen Architekten Conrad Schick* mitentworfenen Wohngebiet begonnen wurde lag diese Gegend noch ausserhalb der Stadt. Fromme Juden zogen aus dem engen Jerusalem nach hier, es folgten orthodoxe - heute ist es eine Stadt in der Stadt.

Mea Shearim wurde 1874 gegründet. Es war eine Initiative von einer Gruppe strengreligiöser Juden, die aus der überfüllten Jerusalemer Altstadt ausziehen und außerhalb der Mauern eine neue, autarke Siedlung gründen wollten. Das Projekt wurde von einer Genossenschaft von 100 Mitgliedern ins Leben gerufen, die Land erwarben und das Viertel als eine Art "Hofgemeinschaft" mit einem geschlossenen Charakter planten, um Sicherheit zu gewährleisten. Conrad Schick spielte eine wichtige Rolle bei der städtebaulichen Gestaltung und Planung des Viertels.
*Conrad Schick, geboren am 27. Januar 1822 in Bitz bei Ebingen war gegen Ende des Jahres 1846 mit einer Gruppe von Missionaren nach Jerusalem gekommen, um dort bei der Gründung eines Bruderhauses tätig zu sein. In Kornthal hatte er die Schlosserei gelernt und in Ebingen sich in der Anfertigung feiner mathematischer Instrumente geübt. Während seiner Wanderschaft als Geselle machte er erstmals Bekanntschaft mit Missionszöglingen. Bald darauf fand er Aufnahme in der Pilgermissionsanstalt in Basel. Von dort führte ihn sein Weg in das Heilige Land. Er sollte hier sein ganzes Leben verbringen. 1850 wurde er Vorsteher des Handwerkinstitutes und bald darauf Bauinspektor der Judenmissions- sowie der Deutschen Missionsgesellschaft. Lange Jahre war er als Architekt für die Stadt Jerusalem tätig. Dies gab ihm Gelegenheit zur Erforschung der alten Stadt. Die Archäologie war zu dieser Zeit in Mode gekommen. Sein Interesse für die Vergangenheit des Landes wuchs, und bald wurde er zum besten Kenner Jerusalems und Palästina seiner Zeit."
Ein Großteil der Bewohner von Mea Shearim, insbesondere die Mitglieder der ultra-orthodoxen Bewegung "Neturei Karta", lehnt den Staat Israel aus religiösen Gründen ab. Sie glauben, dass ein jüdischer Staat erst durch die Ankunft des Messias gegründet werden darf und dass die Gründung Israels durch Menschen ein Verstoß gegen göttliches Recht ist. Dieser Antizionismus ist die primäre politische Haltung in dem Viertel. Einige wenige, extremistische Randgruppen innerhalb dieser anti-zionistischen Strömung haben in der Vergangenheit Symbole verwendet, die eine abscheuliche und schockierende Botschaft senden sollen. Sie setzen Zionismus und den Staat Israel mit dem Nationalsozialismus gleich, um ihre Ablehnung zu unterstreichen. Diese Gleichsetzung ist sowohl historisch falsch als auch zutiefst beleidigend. Das Hakenkreuz wird dabei nicht als positives, sondern als negatives Symbol genutzt, um eine extreme moralische Verurteilung des Zionismus auszudrücken. Es ist eine Form der Provokation und soll eine schockierende Analogie herstellen.
Die äußerlichen Merkmale der ultra-orthodoxen Juden in Mea Shearim, die zu den "Haredim" und oft zu den chassidischen Bewegungen gehören, sind sehr markant und folgen strengen religiösen Vorschriften. Sie sind Ausdruck ihrer tiefen Frömmigkeit und ihres Wunsches, sich von der säkularen Welt abzugrenzen. Die traditionelle Kleidung besteht typischerweise aus einem schwarzen Anzug, einem weißen Hemd und einer schwarzen Hose. Im Sommer kann die schwarze Kleidung auch etwas heller sein, aber die Grundfarbe Schwarz bleibt dominant. Die Kleidung ist meist sehr formell und erinnert an osteuropäische Mode des 19. Jahrhunderts. Ein prägendes Merkmal ist der schwarze Hut. Die genaue Form des Hutes (z.B. flach, hoch, mit Krempe) kann Aufschluss über die Zugehörigkeit zu einer bestimmten chassidischen Dynastie geben. Am Sabbat und an Feiertagen tragen viele chassidische Männer einen Shtreimel, einen großen runden Pelzhut, der ebenfalls auf osteuropäische Traditionen zurückgeht. Das auffälligste Merkmal sind die langen Schläfenlocken, die Pajes (auch Pe'ot genannt). Sie werden gemäß einer biblischen Vorschrift (3. Buch Mose 19:27) nicht abgeschnitten. Die Länge und Form kann variieren. Die Kleidung der Frauen unterliegt den Regeln der "Tzniut" (Bescheidenheit). Dies dient dazu, keine Aufmerksamkeit auf den Körper zu lenken. Viele Frauen tragen eine Perücke, die oft als "Sheitel" bezeichnet wird. Es gibt strenge Regeln dafür, wie sie auszusehen hat, um nicht zu auffällig oder modern zu wirken.