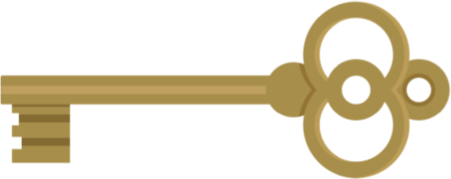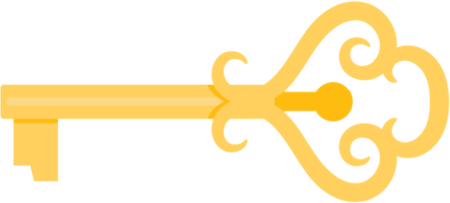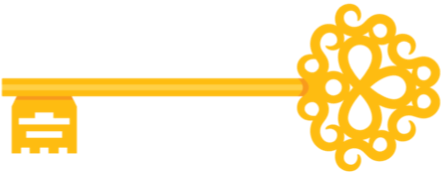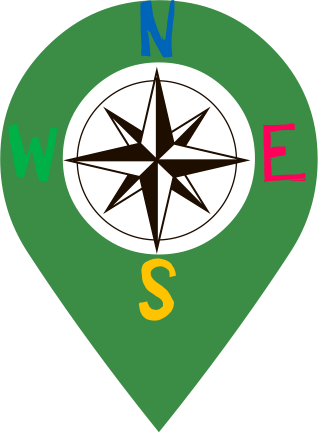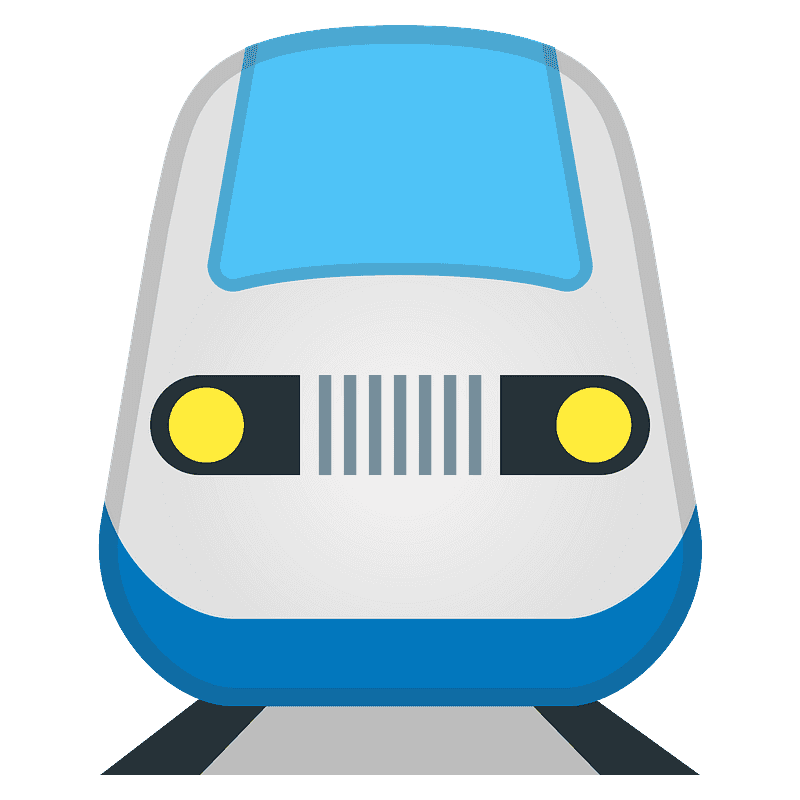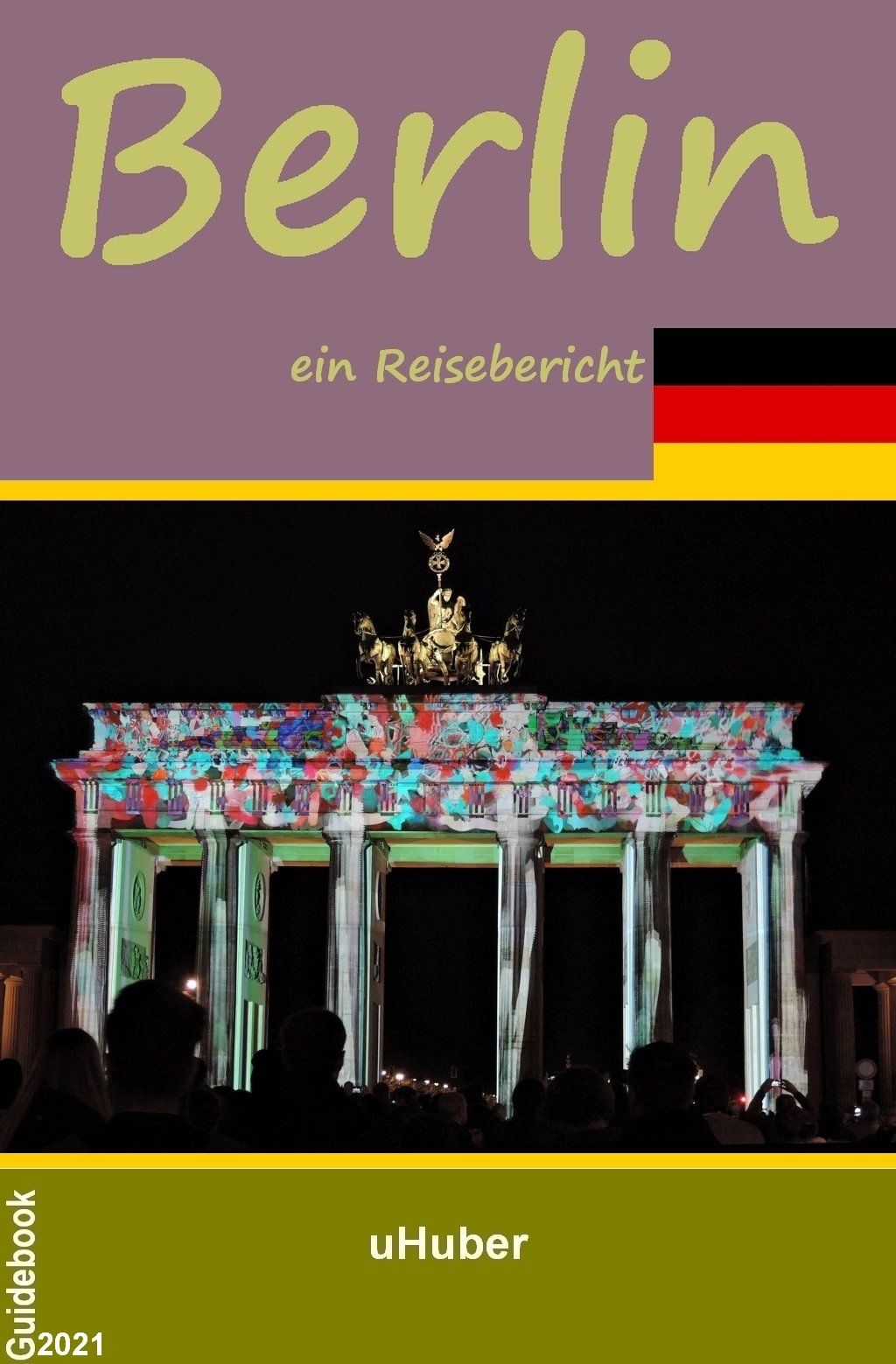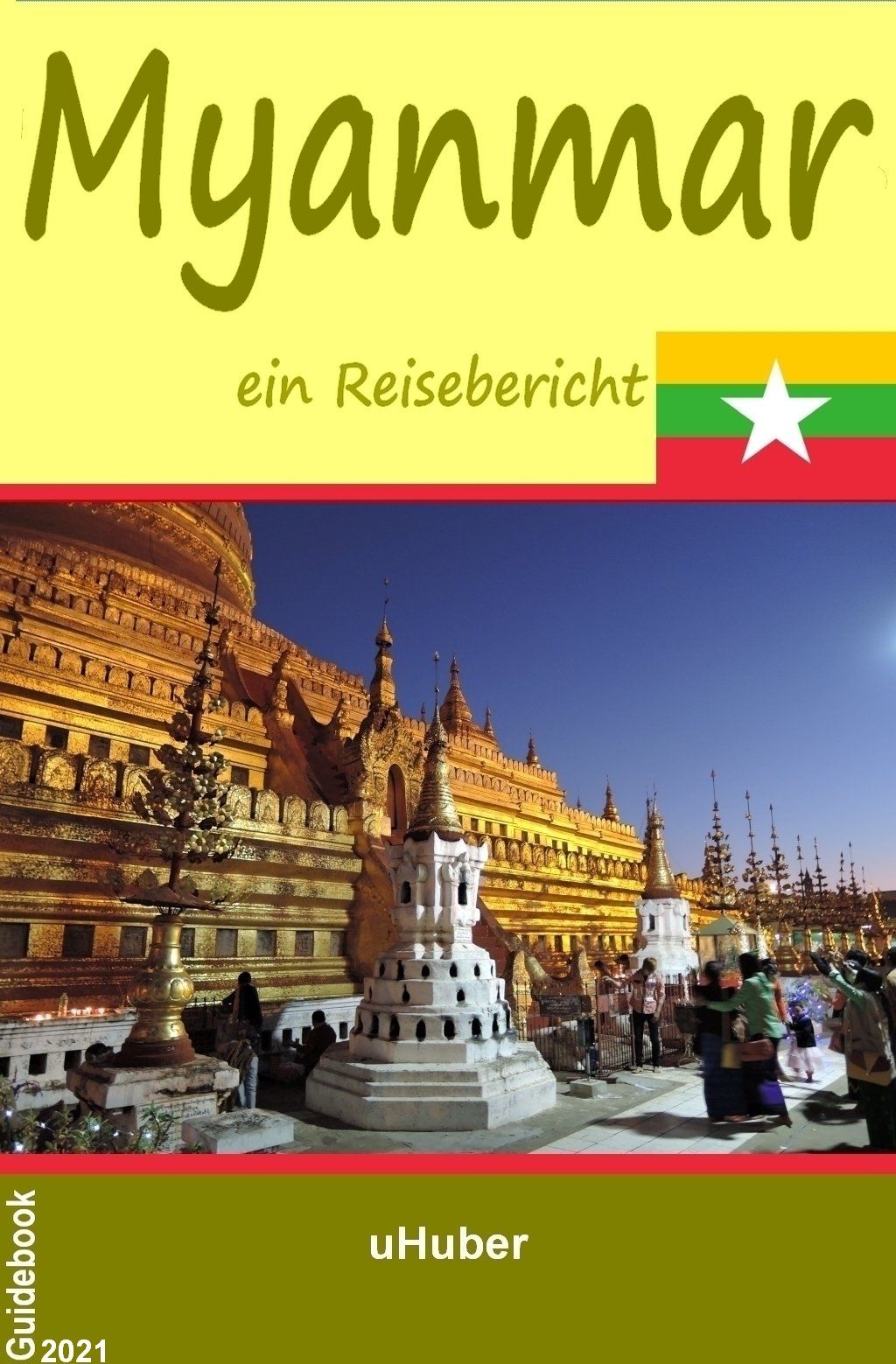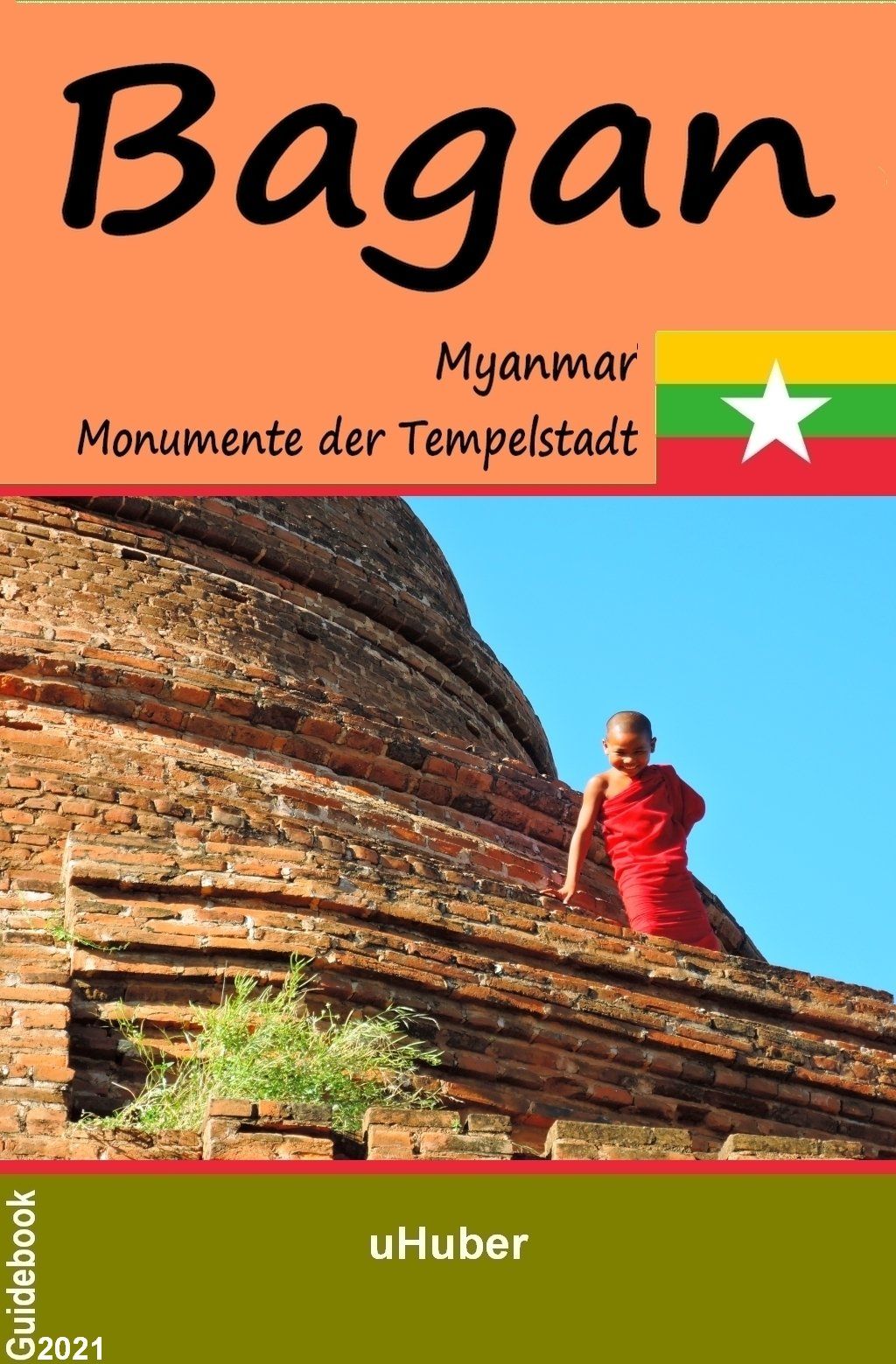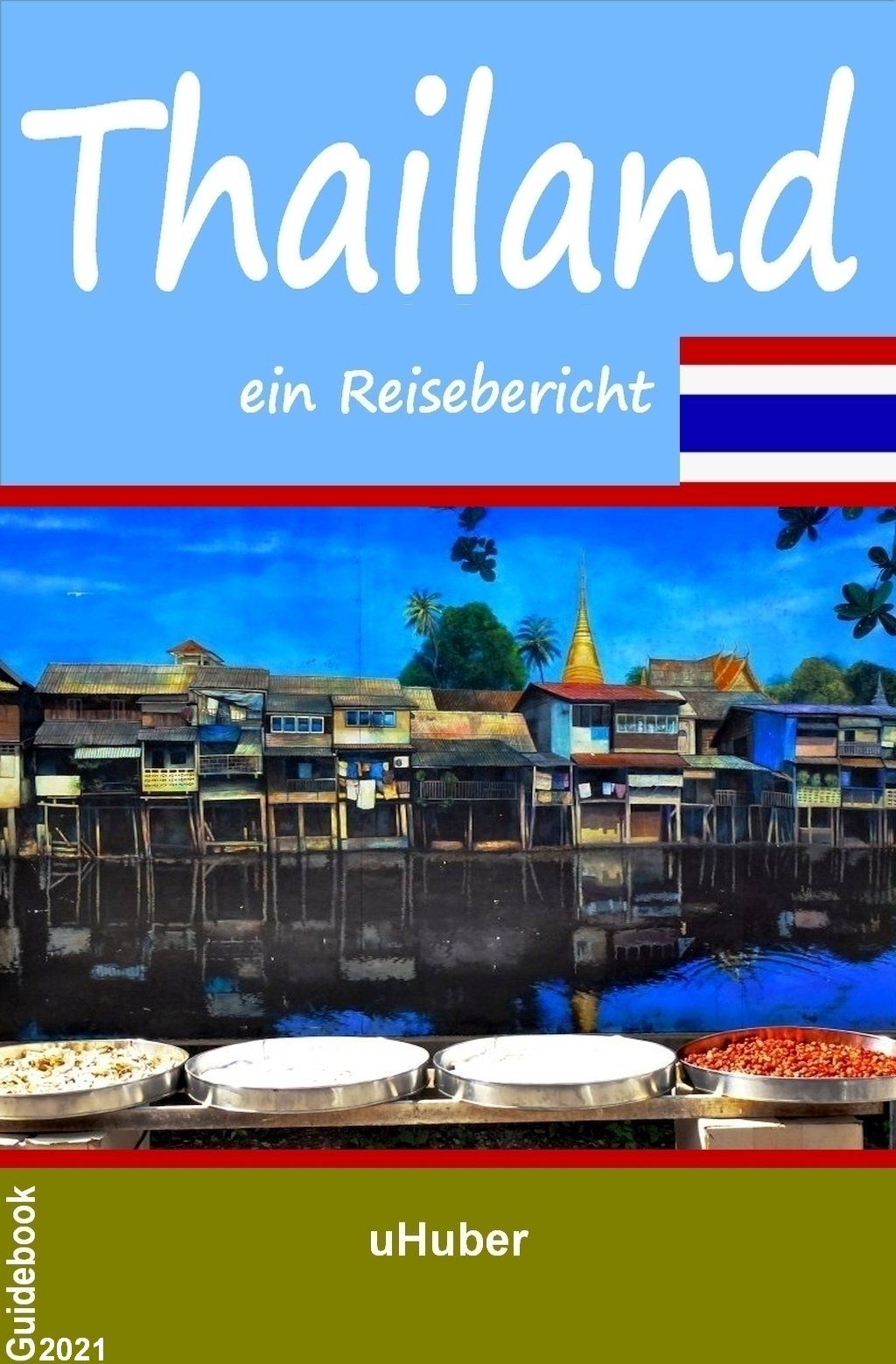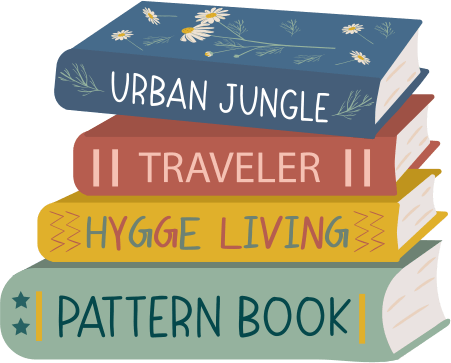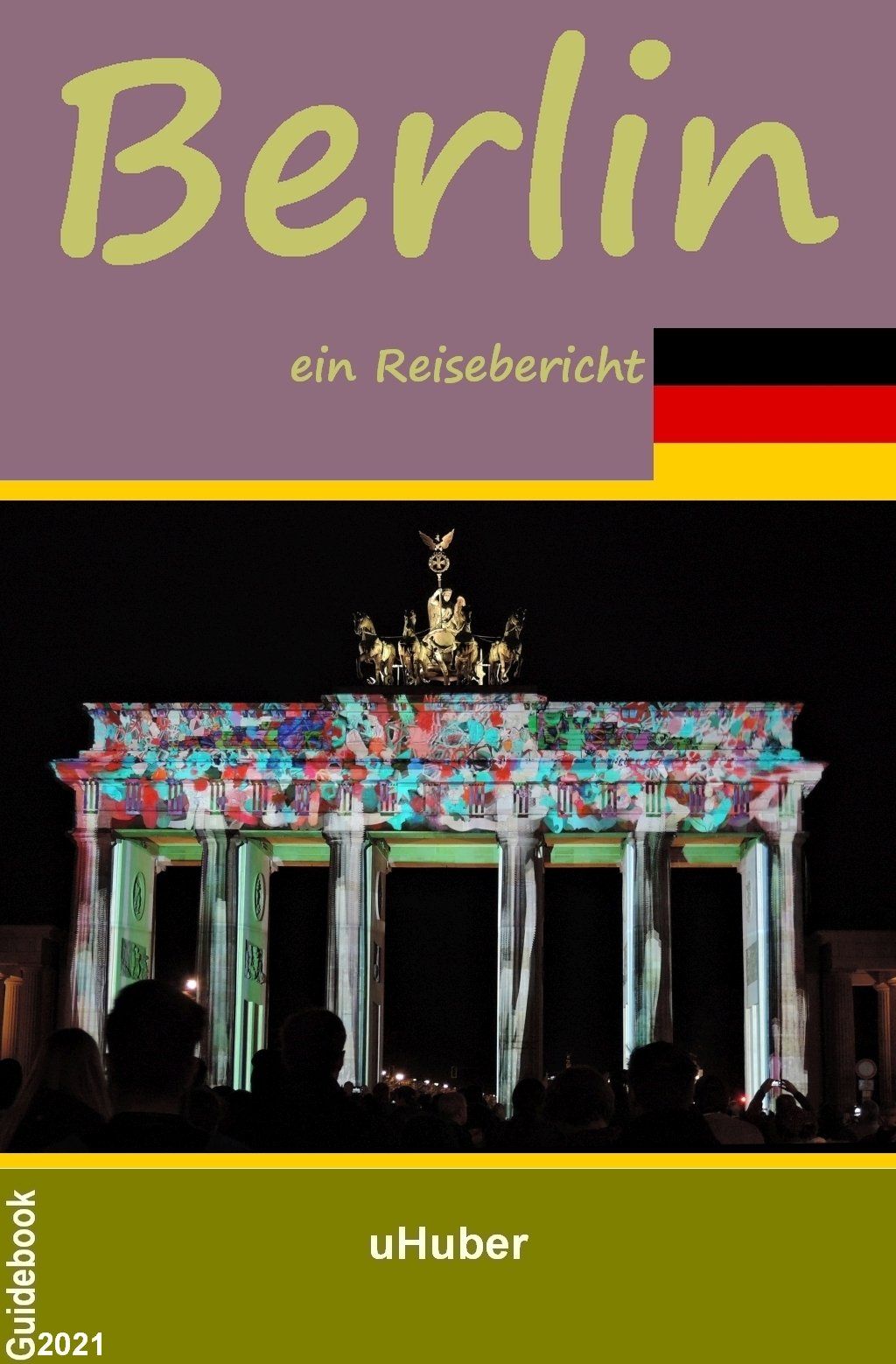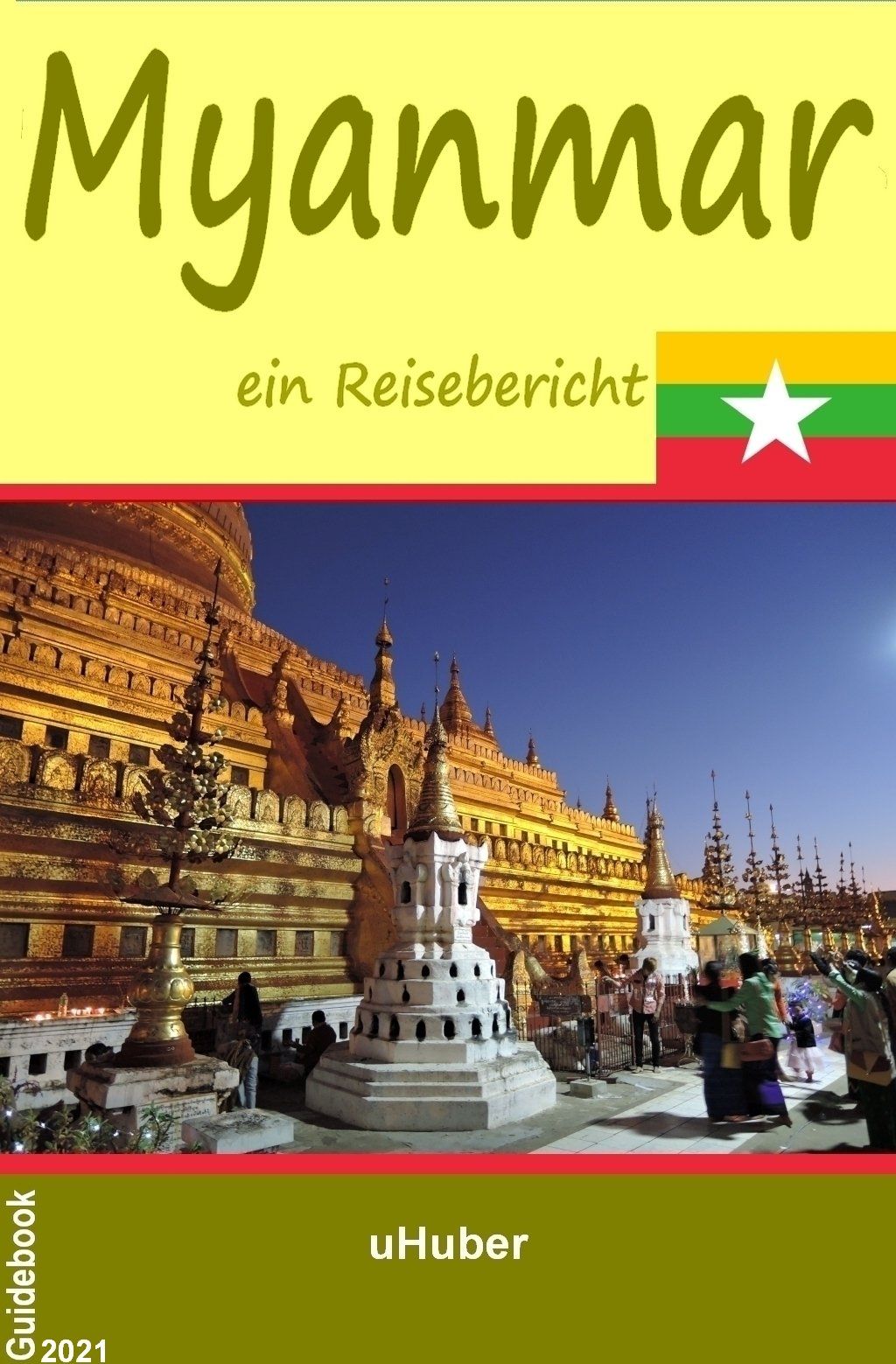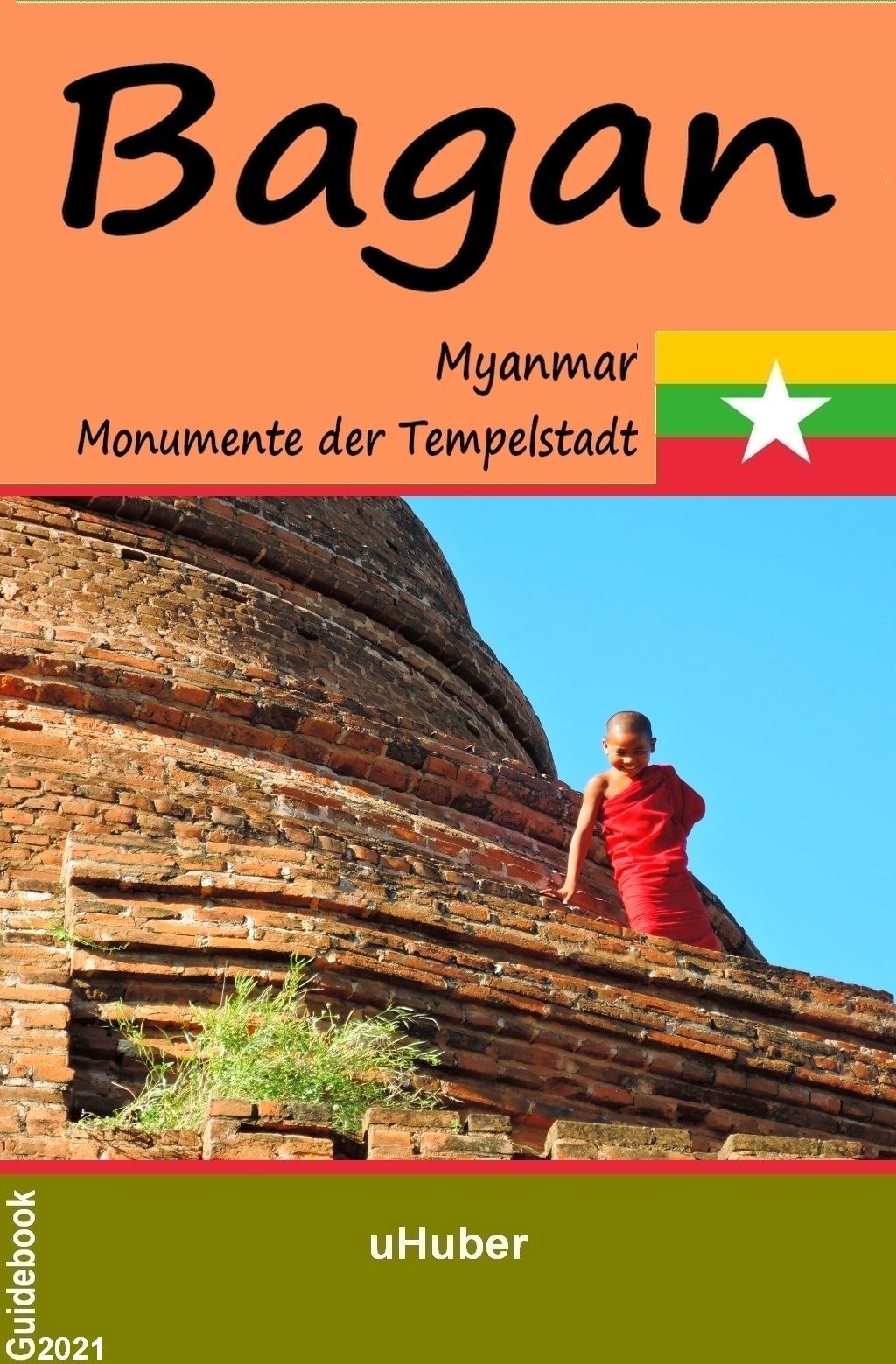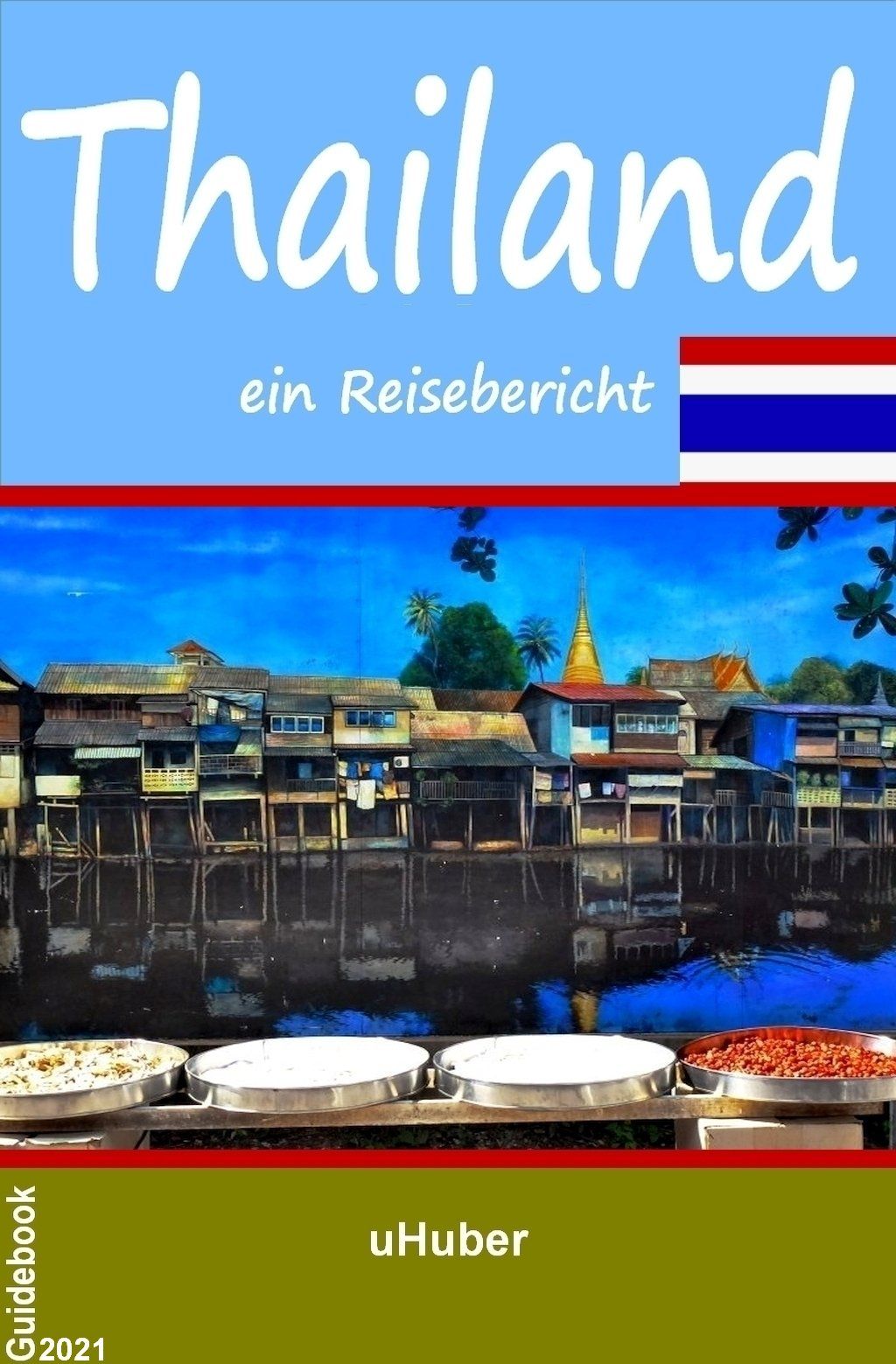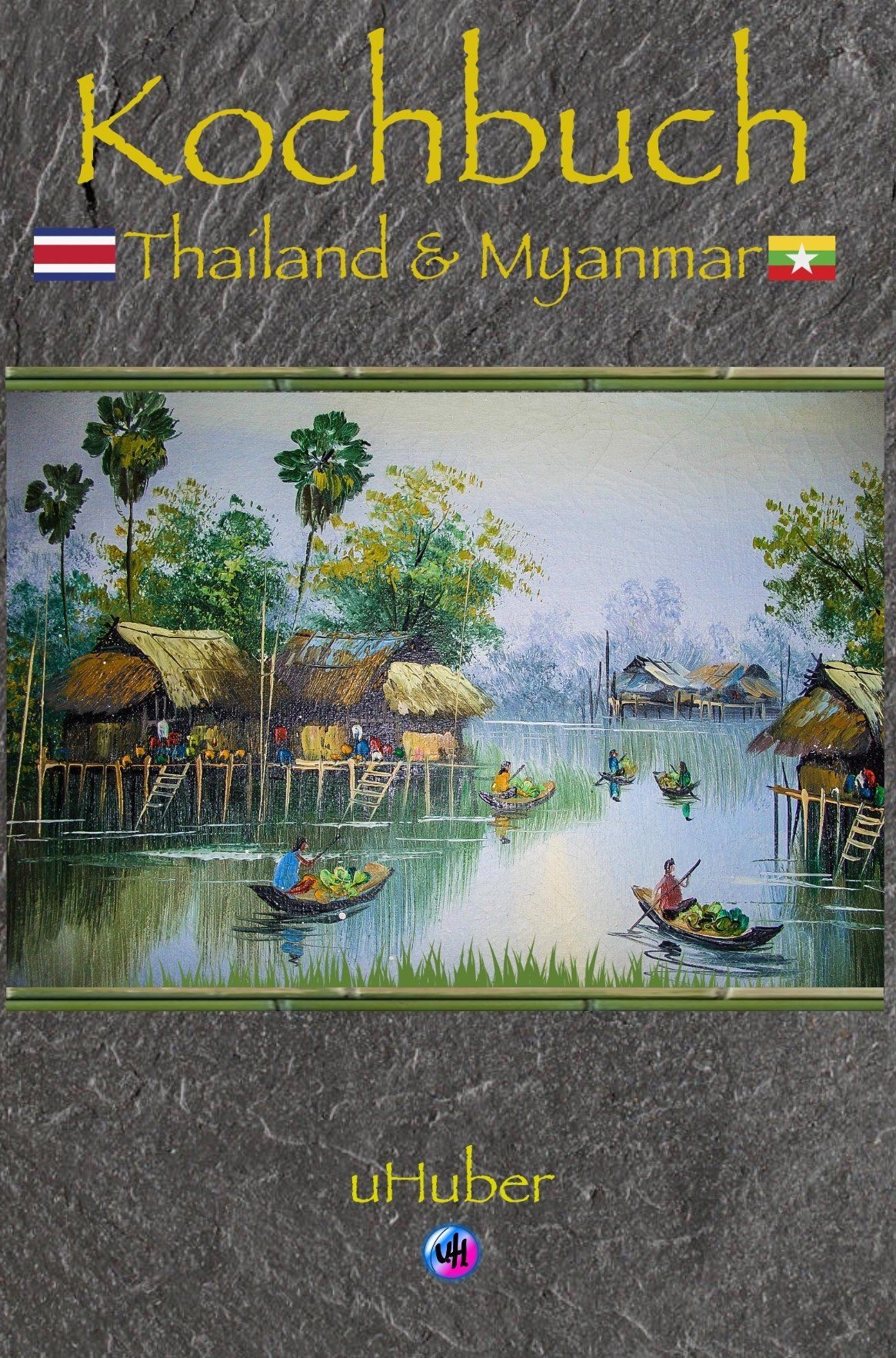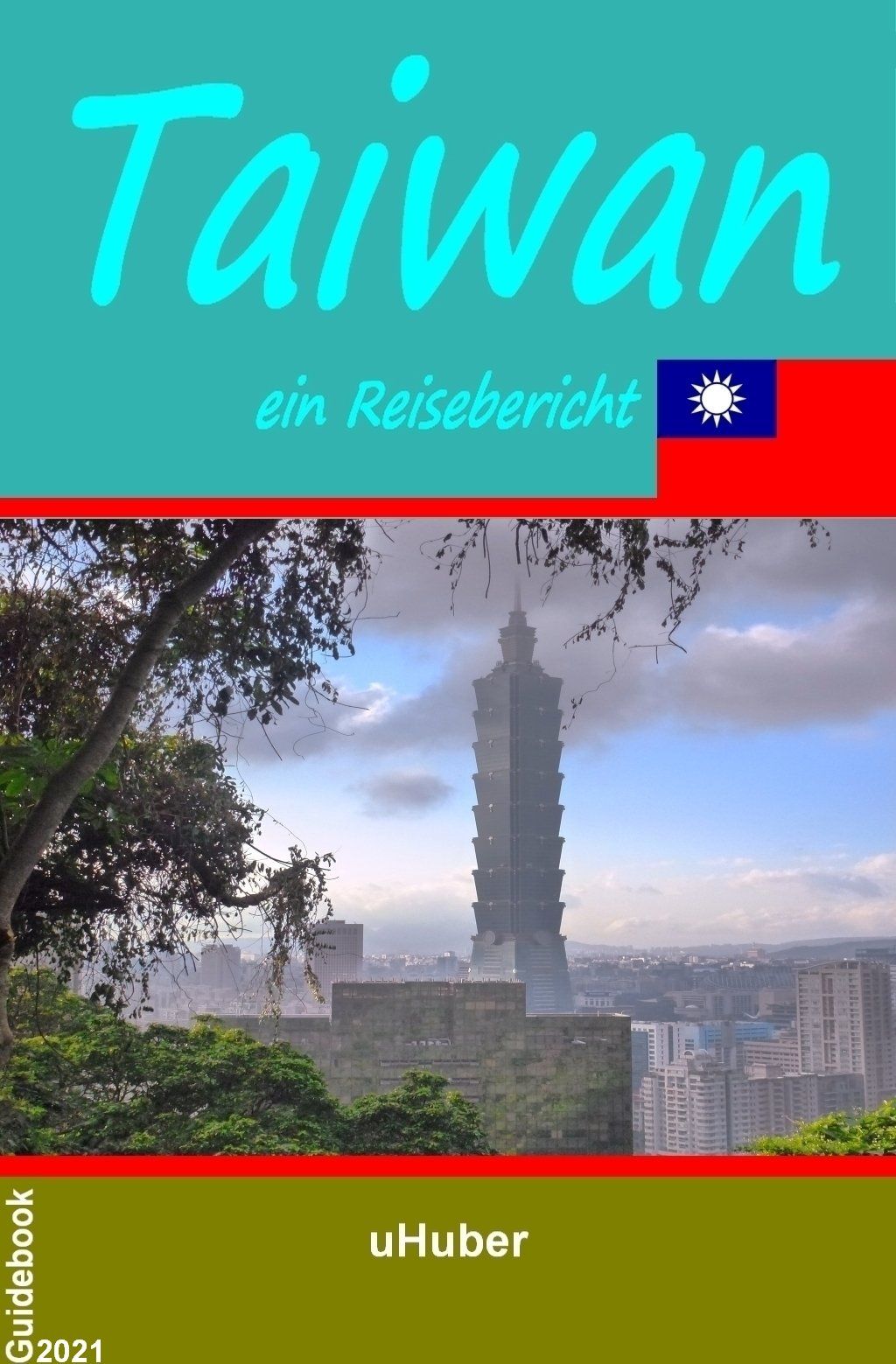Hohenlandin
95 km von Berlin


Keine 15 Kilometer westlich von der Oder, die die Grenze nach Polen bildet und 10 Kilometer nordöstlich von Angermünde liegt die Mark Landin - der Ort Landin findet erstmals 1250 urkundliche Erwänung im Vertrag von Landin zwischen dem Pommernherzog Barnim I. (* um 1210/1218, †13.11.1278 in Altdamm) und den Askaniern. In dem Tauschgeschäft wurde das halbe Land Wolgast gegen die nördlche Uckermark eingetauscht. Vor dem Jahr 1354 gehörte Hohenlandin zu Brandenburg, zwischen 1354 bis 1472 (laut Vertrag von Oderberg am 05. April 1354) war es unter pommerscher Landesherrschaft. Erst nach dem Friedensvertrag von Prenzlau im Jahre 1472 kam Hohenlandin wieder zu Brandenburg. Am 25. Februar 1482 belehnt Johann Markgraf von Brandenburg Claus und Peter von Beren mit Besitzungen zu Hohen-Ladin.

Östlich und nördlich vom Landiner Hausee gruppieren sich die kleinen Gemeinden Niederlandin und Hohenlandin. Die Gutsanlage Hohenlandin enstand gegen Ende des 18. Jahrhunderts und befand sich im Besitz der Familie von Warburg. Freiherr Wilhelm Georg von Warburg (*17.01.1820 in Berlin, †07.06.1885 in Dresden), Herr auf Hohen Landin, ließ 1860 das heute als Schloss (Ruine) Hohenlandin bekannte Herrenhaus auf den Grundmauern des Vorgängerbaus im Tudorstil errichten. Zum Anwesen gehörte auch ein großzügiger Schlosspark, der vom berühmten Gartenbaudirektor Peter Joseph Lenné gestaltet wurde.
Noch in den 1930er Jahren war das Schloss intakt. Baumeister war der Landesbaumeister Ferdinand Neubart aus Wriezen. Verschuldet musste von Warburg es mitsamt der Gutsanlage an die Berliner Unternehmerfamilie (Kalkbrenner) Müller verkaufen. In deren Besitz war das Anwesen bis 1946. Die letzte Gutherrin, Dora Müller, lebte dort und das Gut ernährte zu dieser Zeit einen Großteil des Dorfes, da viele Dorfbewohner auf dem Gut und den dazugehörigen 1000 Hektar Land beschäftigt waren.

Die Besitzer vom Gut und dem Schloss haben mehrfach gewechselt, erstmals genannt wird eine Familie Hans von Wichmannsdorf von 1486 bis 1671. Die letzten Besitzer (Familie Müller) wurde nach der Bodenreform 1946 enteignet und das Schloss verfiel danach zusehends. Es wurde von der DDR-Verwaltung genutzt, unter anderem wurden dort Aussiedler untergebracht und es diente einige Zeit als Schule.
Dorfkirche Hohenlandin
Die Dorfkirche befindet sich gegenüber der Gutsanlage. Die mittelalterliche Kirche von Hohenlandin aus Feldsteinen stammt aus dem 13. Jahrhundert und besteht aus einem Schiff und dem eingezogenen Chor, ohne Turm, dieser ist nach Blitzschlag 1945 und einem Feuer abgebrannt. Der heutige Fachwerkaufsatz mit Walmdach wurde 1958 errichtet. Im Westgiebel befindet sich eine Glocke aus dem Jahr 1480 mit einem Durchmesser von 94 cm, die eine Inschrift und einen hängenden Blattfries aufweist. Die Orgel (von Friedrich Leopold Morgenstern aus Guben) auf der Empore stammt aus dem Jahr 1906.
An der Ostmauer der Kirche befinden sich die mit einem eisernen Zaun umschlossenen Gräber von Richard Ferdinand Müller (*28.02.1848, †03.03.1905) und seiner Frau Johanna Emilie Mathilde Helene Müller, geborene Koeppen (*10.12.1854, †12.02.1921). Eine Volkssage, die mit dem Friedhof in Hohenlandin verbunden ist, erzählt von den "Freitöchtern" eines Amtmannes. Diese sollen unter zwei stattlichen Ahornbäumen auf dem Friedhof ruhen. Der Amtmann soll angeblich durch bösen Zauber seinen Tod auf seine drei Töchter übertragen haben, die daraufhin gleichzeitig starben und gemeinsam auf dem Friedhof begraben wurden.